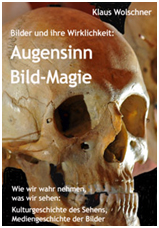|
Gibt es ein „weibliches“ Gehirn? 2022 Bestseller wie das Buch der Neurobiologin Louann Brizendine „Das weibliche Gehirn: Warum Frauen anders sind als Männer“ (2008) oder das Buch „Das Eva-Prinzip. Für eine neue Weiblichkeit” (2006) der Tagessschau-Moderatorin Eva Herman zeigen vor allem eines: Der Streit über „Biologie oder Kultur“, über weibliches und männliches Gehirn gehört zu den kulturellen „Techniken des Selbst“. Gustave Le Bon, der Begründer der Sozialpsychologie, hat 1879 sozialpolitische Folgen abgeleitet aus der Unterschiedlichkeit der Gehirngrößen, die Pierre Paul Broca bei Steinzeitfunden feststellte: „Zweifellos existieren einige hervorragende Frauen, dem durchschnittlichen Mann sehr überlegen“, schrieb er. Die „offensichtliche Unterlegenheit“ der Frauen selbst in der Pariser Bevölkerung könne aber „niemand auch nur für einen Moment bestreiten“, denn deren Gehirne würde „vom Volumen eher denen von Gorillas ähneln als dem am weitesten entwickelten Männergehirn“. G. Le Bon, 1 Recherehes anatomiques et mathematiques sur !es lois des variations du volume du cerveau et sur leurs relations avec l'intelligence. Revue d'Anthropologie, 2nd series, vol. 2, pp. 27-104 (1879) Das Beispiel zeigt: Es ging ihm um das alte Familienbild. Le Bons Argumente spiegeln die Krise der Männlichkeit um die Wende zum 20. Jahrhunderts, die der Historiker Philipp Blom beschrieben hat. Methodische Probleme Psychologische Experimente über Auswirkungen des zyklischen Hormonspiegels sagen zwar, dass es grundsätzlich hormonelle Einflüsse im Gehirn gibt, lassen aber keine eindeutigen Aussagen darüber zu, wie wichtig diese sind für kulturelle Bilder von Weiblichkeit oder Männlichkeit. Und Tierversuche sagen nichts darüber, wie sehr die „tierischen“ Ursprünge des Menschen durch ihre Kultur überformt wird. Für die Unterschiedlichkeit von Menschen gibt es verschiedene geschlechts-unspezifische Worte:
Psychologische Tests ergeben: Die Unterschiede zwischen einzelnen Menschen sind größer als „typische“ statistische Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Erzählung über die evolutionär-biologische Besonderheit des Weiblichen/Männlichen sind nicht willkürliche Erfindungen der Kultur. Diese Erzählungen gewinnen ihre Plausibilität gerade daher, dass sie biologisch verwurzelt sind. Wenn das Empfinden des eigenen Leibes als „Körperselbst“ den Kern des Selbst ausmacht, dann spielt die geschlechtsspezifische Biologie eine große Rolle. Das Bewusstsein über das Körperselbst ist ein sprachlich-kulturell wahrgenommenes Selbstbildnis, es gehört zur Sphäre der Kultur. Es gibt eine Kulturgeschichte der Selbst-Wahrnehmung. Was Frauen- und Männer-Hirne unterscheidet Es gibt keine speziellen geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Großhirnrinde - in dem Bereich des Gehirns, der uns zu intelligenten Wesen macht, Sprache, logisches Denken und komplexe Sinneswahrnehmungen. Aber:
Er gehört zum menschlichen Sexualzentrum, steuert „typisch männliches“ Verhalten und verschaltet: Dominanz, Aggression und den Sexualtrieb. Frauen haben diese Schaltzentrale dagegen nicht. Bei ihnen sind Dominanz, Aggression und Sexualtrieb entkoppelt und werden von verschiedenen Nervenkernen im Zwischenhirn gesteuert.
Zu Beginn des dritten Schwangerschaftsmonats entwickelt der Fötus seine Keimzellen: die Eierstöcke beim Mädchen, die Hoden beim Jungen. Das Y-Chromosom des männlichen Embryos meldet über Botenstoffe an das Gehirn der Mutter, dass er Testosteron braucht, um sich zum Jungen zu entwickeln, und baut Andockstellen für das Hormon auf.
Aber: Welche Fähigkeiten mensch im Laufe seines Lebens entwickelt und ausbaut, liegt an der Sozialisation. Jedes Hirn ist ein „einzigartiges Mosaik" - eine klare Geschlechtszuordnung ist nicht möglich. Erzählungen über Weiblichkeit formen männliches und weibliches Verhalten, also das, was sie erklären sollen. siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=oHJhN2vATRs
|